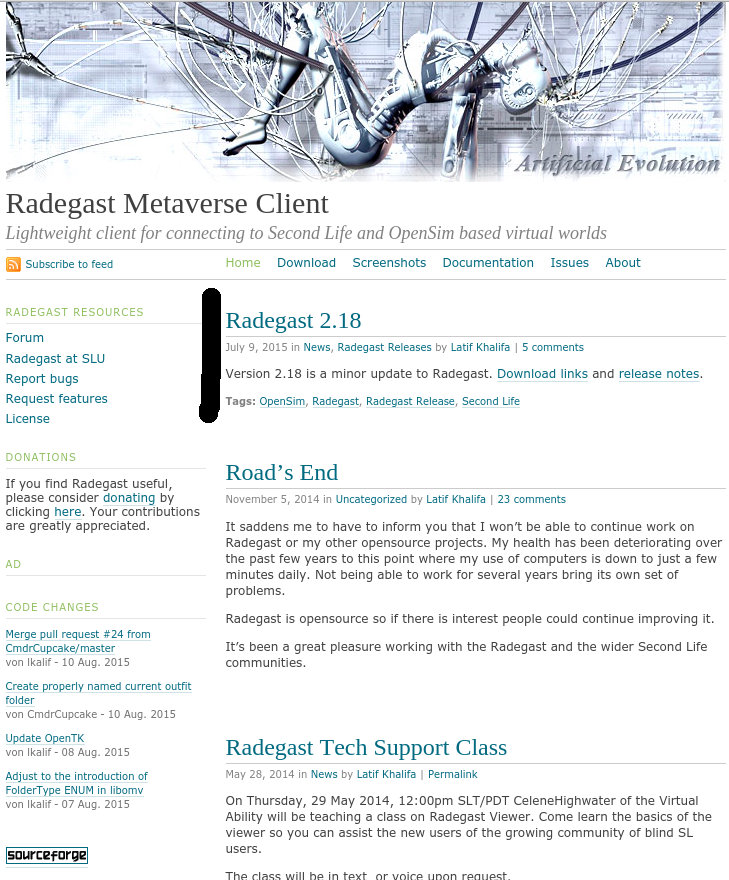Second Life bekommt aktuell Unterstützung für CDNs, also Content Delivery Networks, eingebaut. Aktuell gibt es einen Projektviewer dazu und rund 28 Regionen auf dem Mainland, die das unterstützen.
Das Problem daran ist nur: viele können sich unter einem CDN absolut nichts vorstellen, aber sie benutzen es täglich. Was also ist ein CDN und warum ist es gut?
Ein CDN ist, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk, das Inhalte verteilt. Nehmen wir mal an, ín meiner Gegend gibt es zwei ALDI-Filialen, die eine ist drei Kilometer von mir entfernt und die andere zehn. Nehmen wir weiter an, ich als ökonomisch handelnder Mensch kaufe immer dasselbe Toilettenpapier bei ALDI, das es in jeder Filiale als Eigenmarke vorrätig gibt. Wohin werde ich natürlich fahren? Richtig: zu der Filiale, die näher an meinem Wohnort ist, denn das Angebot in dem Fall ist ja in allen ALDI-Filialen gleich und es gibt für mich absolut keinen vernünftigen Grund, in die weiter entfernte Filiale zu fahren.
Und genau das ist das Prinzip eines CDNs, nämlich die Inhalte eines Diensteanbieters geographisch (!) gesehen wirklich so nahe als möglich an den Abrufer zu bringen. Das geschieht dabei völlig automatisch, transparent und der Benutzer kriegt davon nichts mit. Der CDN-Anbieter muss dafür eine globale Infrastruktur betreiben.
Wie funktioniert das? Nun, in Second Life wird es für Meshes und Texturen freigeschaltet werden. Bekannte Anbieter von CDNs sind beispielsweise Akamai oder Amazon. Wenn ich also in Zukunft als Deutscher eine Textur runter laden will, dann geht diese Anfrage auf CDN-aktiven Regionen nicht mehr direkt an die Rechenzentren von Linden Lab in den USA, sondern an einen Server des CDN-Anbieters, der irgendwo in Europa steht. Der prüft dann zunächst, ob diese Textur schon lokal vorhanden ist, und wenn ja, dann schickt er mir diese direkt, was in einer deutlich besseren Ladezeit resultiert (das ist einfacher Physik und der Übertragungsgeschwindigkeit geschuldet, sprich man hat eine bessere Pingzeit). Wenn die Textur bisher nicht vorhanden ist, dann fordert er diese beim Stammserver an und hält sie danach für weitere Deutsche für eine gewisse Zeit vor.
Das ist alles. Dadurch haben wir dann in Zukunft eine Entkoppelung des Ladens von Texturen und Meshes von der Infrastruktur Linden Labs in den USA, weil das hauptsächlich über das CDN passieren wird. Als Ergebnis wird man eine spürbare Beschleunigung der Ladezeit von oft bzw. oft wiederholt besuchten Sims feststellen können. Wie hoch, das wird sich zeigen .
Zu beachten dabei ist allerdings, dass nach wie vor die Regionserver in den USA stehen und damit die Avatarpositionsberechnung, Physik usw. ausschließlich über dort geschehen wird.